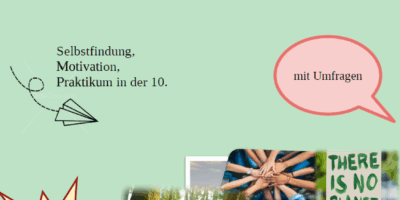Eine Rezension von Laura Visca (Q3).
„Alle fragen mich nur nach Übeln, den ‚Gräueln‘: obgleich für mich vielleicht gerade diese Erfahrung die denkwürdigste ist. Ja, davon, vom Glück der Konzentrationslager, müsste ich ihnen erzählen, das nächste Mal, wenn sie mich fragen.“ (Kertész, Imre: Roman eines Schicksallosen. Berlin. 30. Auflage 2016. Originalausgabe 1975. S. 287.)
 Imre Kertész „Roman eines Schicksallosen“ unterscheidet sich zutiefst von anderer Nachkriegsliteratur, denn er scheibt über das, was er selbst als 14-Jähriger erleben musste, als er 1944 von Budapest nach Auschwitz und später nach Buchenwald deportiert wurde. Allerdings auf eine ganz andere, gewöhnungsbedürftige (an die man sich bis zum Ende des Buches nicht gewöhnt) und groteske Art und Weise. Wenn wir anfangen einen solchen Roman zu lesen, in dem Wissen, welche „Gräueln“ sich in den KZs abgespielt haben, dann tut es weh, ein KZ-Buch von einem Jungen zu lesen, der das nicht weiß und auch nachdem er bloß einen Tag in Auschwitz verbringen musste, um alles was sich dort abspielte zu verstehen, nicht anfängt das zu verurteilen. Diese schonungslose Neutralität und Nüchternheit versteht man jedoch keineswegs als Verharmlosung. Diese Nüchternheit eines Kindes beim Erzählen über Gaskammern ist die schlimmste Form der Anprangerung. Und trotzdem fällt es schwer, die Neutralität vielleicht sogar den Optimismus anzunehmen, weil wir (hoffentlich) so aufgewachsen sind, dass der Holocaust das dunkelste Loch der Menschheitsgeschichte war.
Imre Kertész „Roman eines Schicksallosen“ unterscheidet sich zutiefst von anderer Nachkriegsliteratur, denn er scheibt über das, was er selbst als 14-Jähriger erleben musste, als er 1944 von Budapest nach Auschwitz und später nach Buchenwald deportiert wurde. Allerdings auf eine ganz andere, gewöhnungsbedürftige (an die man sich bis zum Ende des Buches nicht gewöhnt) und groteske Art und Weise. Wenn wir anfangen einen solchen Roman zu lesen, in dem Wissen, welche „Gräueln“ sich in den KZs abgespielt haben, dann tut es weh, ein KZ-Buch von einem Jungen zu lesen, der das nicht weiß und auch nachdem er bloß einen Tag in Auschwitz verbringen musste, um alles was sich dort abspielte zu verstehen, nicht anfängt das zu verurteilen. Diese schonungslose Neutralität und Nüchternheit versteht man jedoch keineswegs als Verharmlosung. Diese Nüchternheit eines Kindes beim Erzählen über Gaskammern ist die schlimmste Form der Anprangerung. Und trotzdem fällt es schwer, die Neutralität vielleicht sogar den Optimismus anzunehmen, weil wir (hoffentlich) so aufgewachsen sind, dass der Holocaust das dunkelste Loch der Menschheitsgeschichte war.
Als der jüdische Junge nach Auschwitz deportiert wird, ist er gerade mit seinen Freunden auf dem Weg zu seiner Arbeit in der Rüstungsindustrie, in der er nun arbeitet, weil er die Schule nicht mehr besuchen darf. Erneut entsteht zwischen Leser*in und dem Erzähler ein tiefes Gefälle, denn einerseits, ist es für uns kaum aushaltbar zu erfahren, dass ein Kind nach Auschwitz kommen wird. Andererseits aber empfindet er die ganze Situation eher als amüsant. Als die Gruppe der ungarischen, deportierten Juden dann erfährt, dass sie nach Deutschland fahren, um zu „arbeiten“, freut er sich sogar, in der Hoffnung die Welt kennenzulernen. Beim Ankommen in Auschwitz, berichtet Kertész von Frauen, die sich in der Eisenbahn „schön […] machen“. Beim Lesen muss man ziemlich schlucken, weil Kerstész die Assoziation weckt, sie würden sich für Liebhaber zurechtmachen, obwohl sie die SS-Männer erwarten. Dass bei der Zugfahrt von Ungarn nach Deutschland Menschen gestorben sind, weil sie kein Wasser bekommen haben, nimmt er einfach als gegeben Tatsache hin. Auch, dass sie ihr ganzes Hab und Gut abgeben müssen, empfindet er als legitim. Wenn er dann das erste Mal die Gefangenen mit dem gelben Dreieck auf der Brust sieht, „war [er] so plötzlich doch irgendwie überrascht; im Laufe der Reise habe [er] diese ganze Angelegenheit fast schon etwas vergessen“. Beim Lesen ist man schon fast ein bisschen wütend, weil man seine Naivität nicht nachvollziehen kann und kurz darauf ist man sauer auf sich selbst, weil man nicht weiß, ob man die Empfindung des Jungen überhaupt anzweifeln darf. Wenn er dann die Häftlinge mit ihren „abstehenden Ohren, hervorspringenden Nasen, tiefliegende[n] winzigen Augen, die schlau funkelten“ beschreibt, macht er noch zusätzlich den Kommentar, dass sie aussehen „wie Juden, in jeder Hinsicht.“ Er will wissen, welche „Verbrechen“ sie begannen haben. „Ich fand sie verdächtig und insgesamt fremdartig“. Diese, für den 14-jährigen Jungen, fremdartig wirkenden abgemagerten Häftlinge in ihren gestreiften Anzügen und abrasierten Köpfen, mahnten die ankommenden Jungen dazu, sich als 16 auszugeben und es zu verschweigen, falls irgendjemand ein Zwilling sei. Natürlich verstand er nicht wieso. Der*die Leser*in weiß natürlich wieso und dadurch entsteht erneut so etwas wie ein Rollentausch von Leser*in und Erzähler*in. Denn eigentlich ist es der*die allwissende Erzähler*in, der*die Hinweise in einem Roman versteckt und nicht anders herum. Die SS-Soldaten beschreibt er als beruhigend und bewundert sie für ihre Ordentlichkeit. Allgemein ist der 14-jährige Junge sehr beeindruckt vom Bahnhof von Auschwitz und redet vom „Glanz der Ebene“. Erst nachdem er aus dem KZ befreit wurde, lässt er diese Situation, das Ankommen in Auschwitz Revue passieren und schreibt, es seien zehn bis 20 Minuten, in denen sich entscheidet: „[G]leich das Gas oder noch einmal davon gekommen“.
Als er nach über einem Jahr KZ wieder nach Budapest kommt, wird er sofort von einem Journalisten gedrängt, über „die Hölle“, die er erleben musste, die er aber gar nicht als Hölle empfand, zu berichten. Stattdessen „versuchte [er] ihm zu erklären, wie es ist, an einem nicht gerade luxuriösen, im Ganzen aber doch annehmbaren, sauberen und hübschen Bahnhof anzukommen, wo einem alles erst langsam in der Abfolge der Zeit, Stufe um Stufe klar wird. Wenn man die eine Stufe hinter sich gebracht hat, kommt bereits die nächste“. In Kertész Roman werden die Stufen und das sehr geregelte Leben von einer zur nächsten sehr deutlich umrissen. Und der Junge macht in seinem Buch sehr deutlich, dass die Zeitabfolgen überlebenswichtig sind, da man, wenn bei der Ankunft schon alles wüsste, was einem bevorsteht, es nicht aushielte. Und erneut fühlt sich man als Leser*in schuldig dafür, seine Blauäugigkeit verurteilt zu haben. Da er die Zeit zum zentralen Aspekt des Überstehens macht und das ohne jede Wertung passiert, ist der „Roman eines Schicksallosen“ wohl eines der einzigen Bücher, die die Frage für die Nachwelt beantworten, wie man es aushalten konnte und eigentlich nie die Schuldfrage stellt. Denn er fand „mit der Zeit Frieden, Ruhe, Erleichterung“. „Wenn es ihnen nicht passte, dann verprügelten sie mich höchstens […], auch so gewann ich Zeit.“
Kertész kommt zu dem Schluss, dass es für ihn nichts bedeutet, Jude zu sein: „[N]ichts, für mich nichts und ursprünglich nichts, solange die Schritte nicht einsetzen“. Er meint, es gäbe bloß gegebene Umstände und „wenn es ein Schicksal gibt, dann ist Freiheit nicht möglich: wenn es aber […] die Freiheit gibt, dann gibt es kein Schicksal“. Er prangert also die Ansicht an, dass man als KZ-Insass*in zwar ein tragisches Schicksal, aber keine Freiheit gehabt habe. Und wenn man in Freiheit lebt, kann man kein tragisches Leben führen. Da er sich dagegen wehrt, ist die Titelauswahl geklärt.
Wieder in Budapest angekommen, verstand er die Lebensweise außerhalb des KZs nicht mehr und wollte es auch nicht. Er empfand Allem gegenüber nur noch „Hass“ und empfand „ ein schneidendes, schmerzliches, vergebliches Gefühl […] Heimweh“ (nach dem KZ).
Kertész beendet seine Erzählung damit, dass er sein „nicht fortsetzbares Dasein fortsetzen“ würde, denn „es gibt keine Absurdität, die man nicht ganz natürlich leben könnte, und auf meinem Weg, das weiß ich schon jetzt, lauert wieder eine unvermeindliche Falle des Glücks auf mich. Denn sogar dort bei den Schornsteinen, gab es in den Pausen zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war“. Möglicherweise hat er Recht. Aber die Absurdität seines Romans, der von Leid, Hunger, dem Tod, Verbrechen und Schmerz handelt, die er zwar nicht unbedingt affirmatiert, aber einiges davon als Glück beschreibt, ist definitiv eine Absurdität, die man nicht ganz natürlich lesen und verstehen kann.
Imre Kertész Roman ist eine Antwort auf die Frage, wie man es im KZ ausgehalten haben kann. Nicht nur ausgehalten, sondern ein Leben leben konnte mit Ordnung, festen Abläufen und Menschen, die man mochte. Und zu diesen konnte z.B. auch ein SS-Arzt gehören, der einen vorläufig vor der Gaskammer bewahrte und als arbeitstauglich einstufte.
Seine Erzählung beginnt als die eines naiven Kindes, dessen Blauäugigkeit man beim Lesen kaum aushält. Das ist aber gerade das, was sein Werk so unterscheidbar macht: auch nachdem Kerstesz um die Systematik der KZs wusste und das Dritte Reich aufgeklärt wurde, bleibt er seinem inneren, nichts Böses ahnendem Kind treu und lässt es durch nichts beeinflussen. Die Unbekümmertheit und die ganz andere Perspektive machen es, dass man versteht, wieso er nicht bloß als „Unschuldiger“ angesehen werden will. Wenn man anfängt, das Buch zu lesen, ärgert eine*n zwar die Naivität, wenn er dann aber mit fortschreitender Zeit davon berichtet, dass er nichts mehr spürt, verkümmert und er nicht mehr wieder erkannt wird, weil er so abgemagert war, dann bricht es einer*m das Herz, obwohl ich glaube, dass Kertész gerade diese Intention nicht verfolgte.
Letzten Endes reiht sich ein Junge in ein System ein und probiert als guter Häftling zu überleben, wodurch ihm sein Leben als Befreiter weniger lebenswert als im KZ vorkommt.
Der „Roman eines Schicksallosen“ ist ein Buch über das Schicksal des Autors, vor dem man nichts als Ehrfurcht vor seiner Leistung haben kann, uns auf schonungslos, sehr ehrliche, glaubwürdige und unaufgeregte Art sein Leben als KZ-Häftling näher zu bringen und uns damit zu verletzen. Es ist definitiv lesenswert, auch wenn es keine leichte Kost ist. 2002 bekam Imre Kertész, berechtigterweise, für „Roman eines Schicksallosen“ einen Literaturnobelpreis.