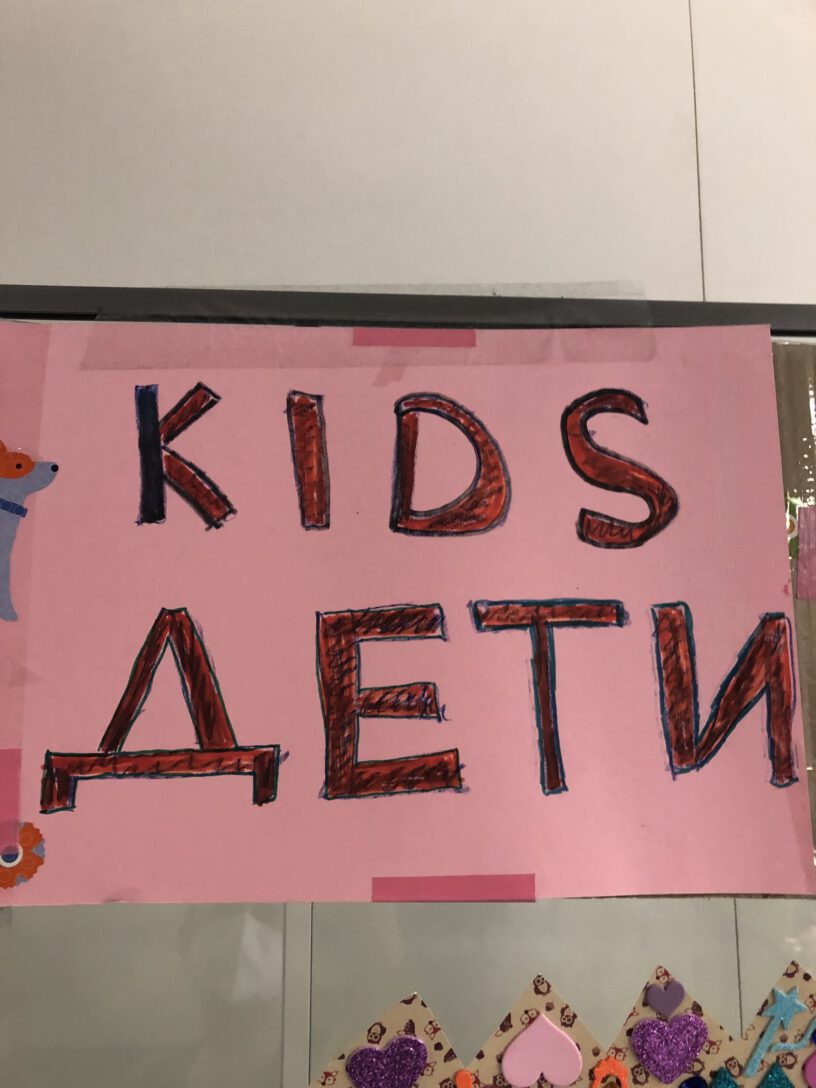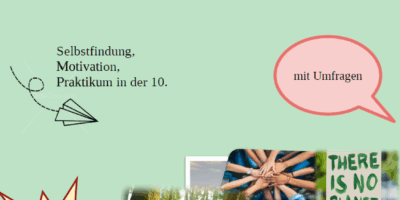Ein Gastbeitrag von Irina Juhl.
 Alles begann mit ein paar kleinen Zelten und einem abgetrennten Bereich inmitten eines der chaotischsten Orte Berlins – dem Hauptbahnhof. Ein Bereich für Ruhe und kurze Erholung, geschaffen für Kinder und ihre Eltern. Eigentlich eine Aufgabe, die schon bei ihrer Fragestellung unerfüllbar zu sein schien: ein Zufluchtsort inmitten der Flucht. Ins Leben gerufen unter dem größtmöglichen Druck der Realität: der täglichen Ankunft tausender Menschen, die über Nacht ihre Heimat verlassen mussten. Menschen, die nur das mitnehmen konnten, was sie auf keinen Fall zurückgelassen hätten: ihre Kinder und ihre Haustiere.
Alles begann mit ein paar kleinen Zelten und einem abgetrennten Bereich inmitten eines der chaotischsten Orte Berlins – dem Hauptbahnhof. Ein Bereich für Ruhe und kurze Erholung, geschaffen für Kinder und ihre Eltern. Eigentlich eine Aufgabe, die schon bei ihrer Fragestellung unerfüllbar zu sein schien: ein Zufluchtsort inmitten der Flucht. Ins Leben gerufen unter dem größtmöglichen Druck der Realität: der täglichen Ankunft tausender Menschen, die über Nacht ihre Heimat verlassen mussten. Menschen, die nur das mitnehmen konnten, was sie auf keinen Fall zurückgelassen hätten: ihre Kinder und ihre Haustiere.
Für die Kuscheltiere oder Schulhefte blieb oft kein Platz mehr in den wenigen Koffern oder Taschen, die sie oft innerhalb von zehn Minuten gepackt haben.
 Die Zelte habe ich persönlich nicht mehr gesehen, nur noch davon gehört. Wenige Wochen nach Beginn der Initiative wurden sie von der Organisation SozDia übernommen und professionalisiert. Statt Zelten sah ich weiße Wände, die an die Trennwände in den Impfzentren erinnerten. Geschmückt mit Kinderbildern und gespickt mit Informationen für die Ankommenden. Und einer langen Liste mit Bedarf an Spenden, auf der die Schulhefte und Kugelschreiber ganz oben stehen, gefolgt von Süßigkeiten und Kuscheltieren.
Die Zelte habe ich persönlich nicht mehr gesehen, nur noch davon gehört. Wenige Wochen nach Beginn der Initiative wurden sie von der Organisation SozDia übernommen und professionalisiert. Statt Zelten sah ich weiße Wände, die an die Trennwände in den Impfzentren erinnerten. Geschmückt mit Kinderbildern und gespickt mit Informationen für die Ankommenden. Und einer langen Liste mit Bedarf an Spenden, auf der die Schulhefte und Kugelschreiber ganz oben stehen, gefolgt von Süßigkeiten und Kuscheltieren.
„Kinder wollen immer Süßes“, sagt eine der freiwilligen Helferinnen und lächelt, was ich trotz Maske an ihren Augen erkenne. Ich nicke und packe meine Mitbringsel aus: viele kleine Tüten Gummibärchen und Lollis. Die Helferin freut sich sehr und ich fühle mich ein bisschen wie ein Osterhase. Dann will ich noch den großen schwarzen Sack leeren, den ich mitgebracht habe. Der ist gefüllt mit Kuscheltieren. Dafür ist ein großer Karton vorgesehen, der gerade noch ziemlich leer und traurig aussah und nun voller Hasen, Katzen und sonstigen niedlichen Wesen ist. Die Kundschaft lässt nicht auf sich warten, viele kleine Hände greifen rein, schnappen, ziehen, betrachten und schließen die neuen kuscheligen Freunde in ihre Arme, ich höre quietschen und glucksen und fühle mich nun wie ein Weihnachtsmann.
Während meiner dreistündigen Schicht im Corner lerne ich viele wunderbare Menschen kennen: eine junge deutsche Frau, die mir stolz erzählt, dass sie inzwischen fast 30 russische Wörter kann, wo sie doch am Anfang kein einziges konnte. Einen sehr jugendlichen, höchstens sechzehnjährigen, der kein Deutsch spricht, nur Englisch und während seiner Schicht unermüdlich aus Papier Hefte bastelt. Oder zwei Frauen aus Sankt-Petersburg, die extra nach Berlin gekommen sind, um als Volontäre zu arbeiten. Sie schlafen in Zelten und duschen am Bahnhof, erzählen sie lachend. Aber sie MUSSTEN es tun, sie konnten nicht länger untätig bleiben.
 Ich gehe und verspreche wieder zu kommen und mehr mitzubringen. Alle Nachbarn und alle Freunde werden informiert, es kommt einiges zusammen, nur am Wichtigsten, an Schulheftern und Stiften mangelt es immer noch. Da kommt mir die Idee, in der Fichte nachzufragen. Schließlich weiß ich noch, wie meine Kinder am Ende jeden Schuljahres manche kaum genutzten Hefte zurückließen. Herr Golus-Steiner ruft zu einer Spendeaktion aus und schon eine Woche später kommen so viele Hefte und Stifte zusammen, dass ich sie alleine nicht zum Auto tragen kann. Ich fahre sie zum Bahnhof am Mittwoch. Als ich am Freitag wieder zu einer Schicht komme ist nichts mehr davon übrig.
Ich gehe und verspreche wieder zu kommen und mehr mitzubringen. Alle Nachbarn und alle Freunde werden informiert, es kommt einiges zusammen, nur am Wichtigsten, an Schulheftern und Stiften mangelt es immer noch. Da kommt mir die Idee, in der Fichte nachzufragen. Schließlich weiß ich noch, wie meine Kinder am Ende jeden Schuljahres manche kaum genutzten Hefte zurückließen. Herr Golus-Steiner ruft zu einer Spendeaktion aus und schon eine Woche später kommen so viele Hefte und Stifte zusammen, dass ich sie alleine nicht zum Auto tragen kann. Ich fahre sie zum Bahnhof am Mittwoch. Als ich am Freitag wieder zu einer Schicht komme ist nichts mehr davon übrig.