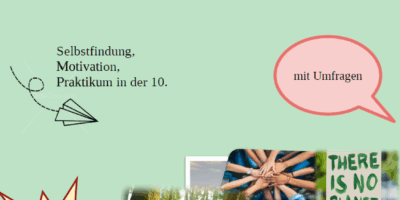Ein Kommentar von Alina Nesrin Gelen zur Abitur-Pflichtlektüre „Corpus Delicti“ (LK Deutsch Q4, Fr. Schubert).
Ein Leben ohne Krankheiten. Frei von Leid und Schmerz. Dies wünscht sich wahrscheinlich jeder von uns. Doch bereits die Grundrechtseinschränkungen während der Corona-Pandemie haben aufgezeigt, dass die rosarote Brille trügerisch ist. Kritiker:innen der staatlichen Eingriffe postulierten, die Einschränkungen würden das Land nicht mehr als Demokratie, sondern als düstere Diktatur entpuppen. Der während der Corona-Debatte häufig herangezogene Roman „Corpus Delicti“ von Juli Zeh scheint genau diese Dystopie einer Gesundheitsdiktatur zu beleuchten. Das scheinbar prominente Thema des Romans „Leben in einer Gesundheitsdiktatur“ hat uns nicht nur im Schulunterricht beschäftigt, sondern veranlasst auch Freunde, Familie und Lehrkräfte zum Nachdenken. Doch ist die Lesart „Leben in einer Gesundheitsdiktatur“ eine einseitige Vereinnahmung des Romans?
Der postmoderne Roman „Corpus Delicti“, welcher im Jahr 2009 von Juli Zeh veröffentlicht wurde, handelt von der Dystopie einer Gesundheitsdiktatur im Jahr 2050, in welcher das Leben eines jeden Individuums von der sogenannten Methode bestimmt wird, welche die Gesundheit zur obersten Maxime erhebt. Im Vordergrund der Handlung steht dabei die Entwicklung der Protagonistin Mia Holl von einer systemkonformen Musterbürgerin zu einer rebellischen Widerständlerin, die nach dem Tod ihres Bruders Moritz mit der totalitären Kontrolle des Systems in Konflikt gerät. Der Roman behandelt dabei ethische, philosophische und politische Fragestellungen, die Themen wie Individualität und Freiheit sowie die Grenzen von Überwachung und Kontrolle beleuchten.
„Ein negativer Zukunftsentwurf“, so fasst Anne Fleig den Inhalt des Romans zusammen und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Doch was meint der Begriff eigentlich? Die Autorin Anne Fleig spielt auf den Begriff einer Dystopie an. Diese beschreibt eine äußerst negative Zukunftsvision, in der die Menschen auf katastrophale Lebensbedingungen stoßen. Definitiv passend, um den Roman „Corpus Delicti“ zu beschreiben. Das Leben in einer Gesundheitsdiktatur, gebrandmarkt durch staatliche Überwachung, die keinen Platz für Privatsphäre lässt. Anne Fleig erklärt, der Roman „Corpus Delicti“ stelle äußerst relevante Fragen der Gegenwart: Welchen Stellenwert hat Gesundheit? In welchem Verhältnis stehen Freiheit und Sicherheit? Und wie viel Vertrauen schenken wir einem Staat, der grundlegende Freiheitsrechte aussetzt? Die Fragen haben eins gemeinsam: Sie gründen auf einem Staat, der die Gesundheit zu obersten Maxime erhebt und Privatsphäre für einen vermeintlich höheren Zweck opfert. Wie dies aussehen kann, das zeigen folgende Maßnahmen der Methode:
Blutwerte, Kalorienverbrauch, Stoffwechselabläufe, Leistungskurven… die Liste scheint kein Ende zu nehmen. Sogar auf der eigenen Toilette ist man vor den Sensoren des Systems nicht sicher. Verrückt! Ein Leben, das für uns kaum vorstellbar ist. Ein Leben, das für uns alle wohl kaum eine Utopie darstellt. So wird deutlich: Der vermeintliche Traum der Sicherheit vor Krankheiten stellt nur einen Deckmantel für die ideologische Agenda und die Dogmen der Methode dar.
Auf das fragile Verhältnis von Freiheitsrechten des Individuums und die für das Kollektiv notwendigen Einschränkungen geht auch Jens Fischer in seinem Kommentar „Theater in der Tiefgarage – isoliert im eigenen Auto“ ein. Im Vordergrund steht die Frage: Wie weit darf die Freiheit für das Streben nach kollektiver Gesundheit eingeschränkt werden? Die Antwort des Romans ist eindeutig. Das Individuum muss hinter dem kollektiven Wohl zurücktreten. Die Legitimation dieser Einschränkung ist, wie bei einer Gesundheitsdiktatur zu erwarten, die Gesundheit.
Es wird deutlich: Der Roman „Corpus Delicti“ beleuchtet definitiv das Leben in einer Gesundheitsdiktatur im Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und kollektiver Sicherheit. Doch reicht diese Lesart, um den Roman in seiner thematischen Diversität zu erfassen? Stellt die Lesart nicht vielmehr einen Tunnelblick dar, der dem vielseitigen Roman nicht gerecht wird?
Nein, denn das eine schließt das andere wohl kaum aus. Keiner von uns würde verneinen, dass in „Corpus Delicti“ die Zukunftsvision einer Gesundheitsdiktatur beleuchtet wird. Dies bedeutet allerdings auf keinen Fall, dass innerhalb der Gesundheitsdiktatur nicht auch andere Themen im Fokus stehen.
Es ist essenziell, die vielseitigen Blickwinkel auf den Roman auf der Grundlage des Lebens in einer Gesundheitsdiktatur nicht zu vernachlässigen. Da wäre zum Beispiel die historische Ebene der Hexenverfolgung. Carla Gottwein beleuchtet diesen Punkt kurz und knackig: Bereits in dem 1486 erschienenen Werk „Hexenhammer“ wird die ambivalente Beziehung zwischen der der Hexerei beschuldigten Maria Holl aus Nördlingen sowie Heinrich Kramer literarisch aufgegriffen. Die durch den Namen offensichtlichen Parallelen zu „Corpus Delicti“ verdeutlichen, dass der Roman eine Vielzahl von gesellschaftlichen Themen behandelt. Eine weitere zentrale Lesart unterstreicht Gottwein, wenn sie erklärt, Juli Zeh konstruiere in „Corpus Delicti“ einen Staat, der scheinbar durch die Mehrheit legitimiert sei und rechtstaatlich agiere. Der Schein, so wird im Verlauf des Romans deutlich, könne nicht mehr trügen: ein Staat, der falsche Beweise im Fall Mia Holl nutzt und sie fälschlicherweise der Trinkwasservergiftung beschuldigt. Doch damit nicht genug! Die Methode nutzt sogar eine falsche Zeugenaussage von „Niemand“, dem gefolterten Würmer, um gegen die rebellische Protagonistin vorzugehen. Neben der Gesundheit, so kann hier festgehalten werden, werden also weitere Themen wie Prozesspraktiken der Hexenverfolgung oder die vermeintliche Rechtstaatlichkeit unter die Lupe genommen. Auch die von der Autorin Carla Gottwein angesprochene Terrorbekämpfung – die im Übrigen die Autorin Juli Zeh selbst in ihrem Roman erkennt – offenbart: Die Interpretationsmöglichkeiten des Werkes nehmen kein Ende!
Die Autorin Juli Zeh affirmiert die Diversität des Werkes unter Beleuchtung des Zeitungsartikels „Bedrohung verlangt Wachsamkeit“ von Heinrich Kramer aus dem Roman: Der Zeitungsartikel zeige in seiner Zuspitzung, wie das Spiel mit apokalyptischen Visionen und Feindbildern das gesellschaftliche Klima vergifte. Tatsächlich kommt es innerhalb der Romanhandlung zu einer staatstragenden TV-Rede des berühmten Journalisten Heinrich Kramer, einem überaus fanatischen Verfechter der Gesundheitsdiktatur, in welchem er Mia Holls Bruder Moritz als Gefährder des Staates beschimpft. In der (scheinbaren) Terrorbekämpfung Kramers habe Zeh, so erklärt sie in „Fragen zu ‚Corpus Delicti‘“, Inspiration von der politischen Rhetorik seit dem 11. September genommen. Die aggressive politische und mediale Rhetorik offenbart eine weitere wichtige Stütze des Romans. Besonders die mediale Komponente des Romans unterstreicht den Einfluss der Medien auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Das Interview mit Kramer in der Fernsehshow „Was alle Denken“ von Würmer beispielsweise wirkt als propagandistisches und populistisches Mittel des Staates zur Machtaufrechterhaltung.
Figuren, die unterschiedliche politische Standpunkte verkörpern – wie im Fall Heinrich Kramer ein eindeutiger Fanatismus und Populismus – offenbaren zahllose Lesarten, die dem Roman zugrunde liegen. Die Frage nach einer zentralen Lesart, nach einem Kern, beschimpft auch Magz Barrawasser als fies. Die tausenden Kerne, die durch die monatelange Arbeit mit dem Stück nach Barrawasser wie eine Zwiebel Schicht für Schicht freigelegt werden können, zeigen die Diversität des Werkes auf. Einen zentralen Punkt macht der Regisseur allerdings fest: „Das Anerkennen der eigenen Verantwortung gegenüber dem System, in dem ich lebe.“ Im Fall „Corpus Delicti“ heißt das offenbar: die Verantwortung des Individuums gegenüber der Gesundheitsdiktatur der Methode. Wie die Verantwortung der Figuren in dem Roman aussieht, könnte verschiedener nicht sein: vom Aufrechterhalten des Systems durch Kramer bis hin zum völligen Hinterfragen des Staates durch Mia.
Magz Barrawasser erklärt dabei: „Wir müssen lernen, unser Denken und Handeln selbst in ein gesellschaftliches System einzuordnen“. Und damit trifft er ins Schwarze! Die zahlreichen Lesarten des Romans, sei es die historische Ebene, die Terrorbekämpfung, die apokalyptischen Feindbilder und und und, eröffnen sich vor ein und derselben Grundlage: dem Leben einer Gesundheitsdiktatur. Sie sind definitiv nicht zu vernachlässigen, begründen die Lesart „Leben in einer Gesundheitsdiktatur“ allerdings definitiv nicht als einseitige Vereinnahmung des Romans. Das eine schließt das andere nicht aus.
Habt also keine Lesart mit Tunnelblick, sondern erfreut euch an den nicht endenden Interpretationsmöglichkeiten des dystopischen Romans „Corpus Delicti“, der das Leben in einer Gesundheitsdiktatur und seine Vielschichtigkeit aufgreift!