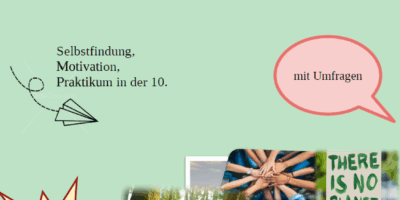Ein Artikel von Resa (Q3)
Ein Klassiker, der überhaupt nichts mit klassischem Theater zu tun hat. Eine alte Geschichte, komplett neu erzählt.
War die italienische Originalfassung 1960 zum Teil noch zensiert, ist die Neuinterpretation das komplette Gegenteil, sodass sich die Zuschauer*innen an so manchen Stellen die Frage stellen mussten, will ich das eigentlich sehen? Das Stück spielt mit Grenzen, nicht nur mit Schamgrenzen des*der Einzelnen, sondern vor allem mit Grenzen im Kopf – wie weit kann oder darf Theater gehen? Vor allem, wie politisch darf Theater eigentlich sein.
Die Geschichte von Rocco und seinen Brüdern, die von Süd- nach Norditalien zogen, um Arbeit, Glück, ein neues Leben und vielleicht auch eine neue Heimat zu suchen, erzählt von einem US-amerikanischen Immigranten, dessen Familie eigentlich aus Südamerika kommt. Bei diesem Stück ist alles ein wenig anders und unkonventionell. Rocco, gespielt von Fridolin Sandmeyer, ist zunächst einer, der auf der Bühne aufgrund seiner Rolle wenig auffällt. Ein schmächtiges Etwas, dem man wenig Beachtung schenkt, da man viel zu sehr mit seinem Bruder Simone, der vom rechten Weg abgekommen ist und dessen Rolle die ganze Bühne und die Aufmerksamkeit der Zuschauer*innen einnimmt, beschäftigt ist. Irgendwann gibt es einen Cut und die ganze Geschichte wandelt sich, auch ist man sich nicht sicher, ob die Schauspieler*innen nur eine weitere Rolle spielen oder von sich erzählen. Die eine auf Einladung der BRD als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen, der andere Schweizer mit jugoslawischen Wurzeln. In diesem Kontext ist es angebracht, den nach dem Jugoslawienkrieg zerfallen Staat zu nennen und nicht einen der Nachfolgestaaten wie beispielsweise Kroatien. Denn welchen Staat er nun seine Heimat nennt, wo er wirklich zu Hause ist, konnte der damals Jugendliche sich auch nicht beantworten. Er erzählt, dass er in den Ferien immer in dieses zu Hause gefahren ist, wo auch immer auf dem Balkan das war, um es wieder aufzubauen. Um nach den Ferien stets auf all die anderen in seinem Alter zu treffen, die sich nicht mit der Frage, was Heimat eigentlich ist, auseinandersetzen mussten und die sich nicht vorstellen konnten, was jetzt in ihm vorging. Alle Protagonisten*innen philosophierten in diesem Vakuum der Handlung, die wie eine Pause vom Stück war, darüber was Heimat ist und erzählten alle ihre ganz eigenen Geschichten über Heimat, die letzten Endes auch in jedem*jeder von uns steckt. Ob die ganzen Geschichten, die der Erzähler Oscar Olivo immer wieder zwischendrin erzählt oder die die anderen Schauspieler*innen erzählen, auch zu 100% die ihren waren, wurde irgendwann irrelevant. Für den Abend waren sie das auf jeden Fall. Und trotz der teilweise grenzwärtigen Szene und der Antipathie, die einige Rollen auf der Bühne mit sich brachten, war die schauspielerische Leistung grandios.
Auch das Zusammenspiel aus Schauspielerei, Oper, Musiktheater und filmischen Elementen wirkte so, als hätte es auch auf der Bühne schon immer zusammengehört. Der Raum, der allen Rollen, egal wie groß sie waren, eingeräumt wurde, sowie der tiefe Einblick in die Schauspieler*innen selbst, die an den Texten zum Teil mitgeschrieben haben, machte den Abend zu einem ganz ungewöhnlichen Theatererlebnis. Bei der Premiere herrschte Spannung im Saal – wie kommt das Stück an, sind die Grenzen der Zuschauer*innen überschritten worden?
Mutig, innovativ, anders
„Du darfst keine Angst haben“ (Rocco, Hauptrolle), und das Ensemble sowie die künstlerische Leitung hatten keine Angst. Der Neu-Adaption lag ein geniales künstlerisches Konzept zugrunde. Gestern noch ein „Arbeiter-Epos“, das von ganz unten erzählte, ist die Theateradaption ein ebenso gesellschaftskritisches Stück wie eine Abbildung der heutigen Gesellschaft. Das internationale Team, die auch auf der Bühne teilweise ihre Muttersprache sprachen, rundete das Konzept ab. Doch war die Idee gewagt. Theater bei dem alle nur die Hälfte verstehen? Fast. Die Tatsache, dass auch das Publikum sehr gemischt war und somit die unterschiedlichen Leute auch den unterschiedlichen Sprachen folgen konnten, sorgte für Lacher und Verständnis an unterschiedlichen Stellen, auf eine ganz besondere Art. Die einen verstanden eben Russisch, jedoch kein Spanisch. Bei anderen war das umgekehrt, jedoch sorgte diese Ausgewogenheit dafür, dass es die unterschiedlichen Leute nicht nur ansprach, sondern zusätzlich die Vielfalt des Publikums und jeder multikulturellen Gesellschaft widerspiegelte. Somit war das Theaterstück auch ein Zusammenspiel mit dem Publikum. Und mit den unterschiedlichen Erfahrungen, die nicht nur die Schauspieler*innen, sondern alle Menschen in ihrem Leben gemacht haben, und in Anbetracht der jetzigen politischen Stimmung in Bezug auf Heimat ging das Ensemble des DNT gemeinsam mit den Zuschauer*innen der Frage nach, die beinah metaphysischen Charakter hat. Was ist überhaupt Heimat?
Das Stück geht von der Reflexionsfähigkeit seiner Zuschauer*innen aus, ohne diese es missverstanden oder überhaupt nicht verstanden werden könnte. Es geht nicht nur reflexiv mit unserem individuellen Heimatbegriff um, z.B. durch historische sowie Ländervergleiche. Zusätzlich reflektiert es auch über unsere jetzige gesellschaftliche Lage in der BRD, die u.a. durch den starken Rechtsruck doch bedenkliche Tendenzen annimmt. Einziger Kritikpunkt dabei ist, dass zum Ende des Stückes ein filmisch aufgearbeiteter Dialog zwischen Rocco und seiner großen Liebe, Nadia, die vorher mit seinem Bruder Simone ging, gespielt von Simone Müller, im Großformat gezeigt wurde und er sie überredet, dass es das beste sei, zu Simone zurückzukehren. Dies obwohl sie ihm ihre Liebe gesteht und ihn fragt: „Wa,s wenn ich das nicht will?“ Ihm ist das egal, denn Familie kommt vor der Liebe und wenn Nadia (die große Liebe) dafür sorgen kann, Simone in die richtige Spur zu bringen, sei sie dieses Opfer wert. Nadia, eine vielschichtige Person, die ihren Körper ihr Leben lang verkaufen musste, um über die Runden zu kommen, dachte in Rocco jemanden gefunden zu haben, der sie auffängt und schätzt. Wieder einmal wird mit der Frauen*figur letzten Endes leider nur gespielt. Zuerst als Objekt, die mit zwei der Parondi Brüder hat laufen hat und sich prostituieren muss, um der Armut zu entfliehen. Später als eine Person, die keine Entscheidungsmacht über sich selbst besitzt. Letzten Endes wird sie im Film und im Stück von Simone, den sie ja irgendwo emotional retten sollte, ermordet.
Ja, der Film kommt aus den 60er-Jahren, wo Frauen*- und Selbstbestimmungsrechte nur wenig vorhanden waren und sich vieles erst noch erkämpft werden musste. Auch sind Frauen* bis heute keine gleichberechtigten Individuen, was u.a. an der Genderpay-Gap oder der „Nein-heißt-Nein!“/“Nur Ja heißt Ja“-Debatte, um die Verschärfung des Paragraphen, der bei sexueller Nötigung greift, geführt wird, zu sehen ist. Aber, durch die Darstellung der hörigen Frau, die nicht selber entscheiden kann delegitmiert sich das Stück leider ein stückweit selbst. Denn bis auf diesen Punkt ist es durchweg ein reflektiertes Stück von Menschen, denen man ihre Reflektiertheit auch abkauft. Ein Stück das mutig ist. Weshalb konnte die Inszenierung dann nicht auch so viel Mut beweisen und die Figur der Nadia als starke Frau, anstelle des hörigen kleinen Mädchens, das zurück in ihre Rolle gedrängt wird, darstellen? Das wäre nun wirklich einmal mutig gewesen.
Bei solch einer Adaption von Stücken (mit minimalem Korrekturvorschlag) könnte Theater glatt dem Fernsehen die Popularität streitig machen. Viele andere junge Menschen in Weimar sahen dies scheinbar ähnlich, denn der Saal war voll mit ihnen. An einem Samstagabend mal lieber ins Theater als gleich zur Party?
Ein Stück, das trotzdem die Frage aufwirft, warum es für all die vielen Antirassist*innen so schwer ist, gleichzeitig auch Antisexist*innen zu sein.