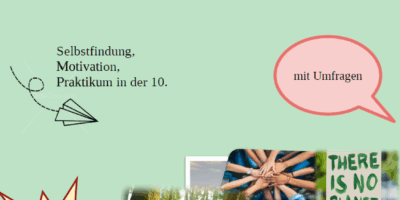Ein Beitrag von Antonia Nolde (Q2).
Programmieren wollte ich eigentlich nie lernen. Wozu auch? Irgendwer kann es eh immer besser, und außerdem ist das quasi Mathe oder so. Tja, so sollte man nie an eine Sache herangehen. Schon gar nicht, wenn man nicht weiß, was einem das Programmieren ermöglicht.
Auf der IFA mache ich erste Erfahrungen. Ein kleines Gerät, verbunden mit einem iPad. Meine Freundin und ich probieren die Bausteine aus, die man aneinander reiht und so Befehle an das Gerät gibt. Einmal die Farbe Grün blinken lassen, einmal „düdeldü“ spielen. Und es funktioniert. Die Motivation steigt. Obwohl ich im Hinterkopf habe, dass die Leute aus dem Informatik-LK vermutlich die Augen verdrehen würden. Klar, im Prinzip spielen wir hier noch mit Duplosteinen. Also auf zur nächsten Station: Lego. Dazu gibt es dann noch eine App, die einem verschiedene Modelle aus Lego anbietet, die man dann mithilfe von zwei kleinen Gerätschaften programmieren kann. Diese App ist eigentlich für Grundschüler*innen, und so sehen letztendlich auch die Aufgaben-stellungen aus. Man muss immer zwei Figuren namens Max und Mila bei ihren Problemchen helfen; hier mal ein Windrad bauen, das sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit drehen soll, da einen Satelliten. Das Bauen macht Spaß, erinnert an die Kindheit. Und dann muss man erstmal nachdenken. Das ganze funktioniert auch wieder nach dem Bausteinprinzip; trotzdem muss man erst einmal verstehen, was man wie machen muss, um das zu erzielen, was gefordert ist.
Letztendlich wende ich mich dann aber doch an jemanden aus dem Informatik-LK: Womit fange ich an? Sie lernen momentan Java, Python sei aber ähnlich „einfach“. Ich nehme mir vor, in die Bücherei zu gehen und mich über Python zu informieren. Aber wozu gibt es das Internet!? Die Website „codeacademy.com“ gibt einem kostenlosen Unterricht in verschiedenen Programmiersprachen. Ich klicke Python an und schon geht es los. Es macht Spaß, das ganze ist in Units unterteilt, es gibt immer ein Erklärfenster und eines für eine Aufgabe, die man bewältigen muss. Sollte man einmal nicht weiterkommen, bekommt man einen Tipp. Irgendwann fange ich an, mir ein Notizheft anzulegen, in dem ich mir die Befehle notiere, um den Überblick nicht zu verlieren. Ich bekomme immer mehr Spaß am Programmieren, genau wie meine beste Freundin Nika. Statt zusammen bei unserer nächsten Übernachtung „The Walking Dead“ zu schauen und uns über die Charaktere aufzuregen, sitzen wir in aller Ruhe auf Ninas Bett und coden. Gemeinsam, nicht jede für sich.
Dann kommen die Weihnachtsfeiern. Ich code eine ganze Weile nicht mehr. Bis Nika mit einer Idee ankommt, die uns beide begeistert: Ein Coding-Camp. Sofort fragen wir unsere Eltern, die sind einverstanden, dann geht es los. Also – noch nicht wirklich. Erst in den Winterferien können wir uns vier Tage Coding „gönnen“. Uns mailt der Chef des Camps und lädt uns zu „Slack“ ein: WhatsApp für Programmierer*innen. Als ich auf den Profilbildern der anderen auch weibliche Gesichter erkenne, bin ich etwas erleichterter. Und schließlich ist Nika ja auch noch dabei.
 Ich habe keine großen Erwartungen an das Camp. Was für ein Projekt kann man schon in vier Tagen beenden? Trotzdem stelle ich meine Idee bei der Präsentation vor. Vier Jungs haben Bock, mit Nika und mir einen intelligenten Blindenstock zu programmieren. Ich rufe Samantha und Özge, zwei Freundinnen von mir an und erkundige mich nach ihren größten Problemen im Alltag. Das Ergebnis: Hindernisse. Wir verteilen die Aufgaben. Einer entwirft die Karte für die Navigation mithilfe von GoogleMaps, zwei andere Jungs kümmern sich um das Voiceover, einer um unsere Website. Nika und ich beschäftigen uns mit dem Stock an sich. Hier lerne ich, dass das „kleine Gerät“, dass ich auf der IFA ausprobiert habe, ein sogenannter Arduino ist. Mit diesem Ding werden wir also vier Tage lang arbeiten. Pascal, ein Student der sogenannten <ode-University (ja, das „<ode“ wird extra so geschrieben), die das Camp auch unterstützt, kennt sich damit sehr gut aus und hilft uns, wenn wir Fragen haben. An der <ode-University werden drei Studiengänge angeboten: Bachelor of Arts in Software Engineering, Bachelor of Arts in Interaction Design und Bachelor of Arts in Interaction Design. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse und lernt an richtigen Projekten, wie das entsprechende Fach in der Realität funktioniert. Doch das würde zu weit gehen. Also zurück zum Codecamp.
Ich habe keine großen Erwartungen an das Camp. Was für ein Projekt kann man schon in vier Tagen beenden? Trotzdem stelle ich meine Idee bei der Präsentation vor. Vier Jungs haben Bock, mit Nika und mir einen intelligenten Blindenstock zu programmieren. Ich rufe Samantha und Özge, zwei Freundinnen von mir an und erkundige mich nach ihren größten Problemen im Alltag. Das Ergebnis: Hindernisse. Wir verteilen die Aufgaben. Einer entwirft die Karte für die Navigation mithilfe von GoogleMaps, zwei andere Jungs kümmern sich um das Voiceover, einer um unsere Website. Nika und ich beschäftigen uns mit dem Stock an sich. Hier lerne ich, dass das „kleine Gerät“, dass ich auf der IFA ausprobiert habe, ein sogenannter Arduino ist. Mit diesem Ding werden wir also vier Tage lang arbeiten. Pascal, ein Student der sogenannten <ode-University (ja, das „<ode“ wird extra so geschrieben), die das Camp auch unterstützt, kennt sich damit sehr gut aus und hilft uns, wenn wir Fragen haben. An der <ode-University werden drei Studiengänge angeboten: Bachelor of Arts in Software Engineering, Bachelor of Arts in Interaction Design und Bachelor of Arts in Interaction Design. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse und lernt an richtigen Projekten, wie das entsprechende Fach in der Realität funktioniert. Doch das würde zu weit gehen. Also zurück zum Codecamp.
Wir wollen einen Ultraschallsensor anbringen. Dafür suchen wir uns den entsprechenden Code im Internet und kopieren ihn einfach in das Programm – schließlich drängt die Zeit. Pascal schleppt drei riesige Kisten voller Zubehör an, denn außer dem Arduino und dem Sensor brauchen wir natürlich Kabel und Widerstände. Für die Kabel gibt es genaue Vorgaben, welche in welchen Kanal des Arduinos gesteckt werden müssen. Das Board, auf dem wir den Sensor anbringen, wird durch die Kabel mit dem Arduino verbunden. Um einem Kurzschluss vorzubeugen, benutzt man Widerstände. Zu überlegen, wo und wie diese in das Board gesteckt werden, ist eine ganz schöne Herausforderung. Und schwups, schon ist der erste Tag vorbei. Leckeres Essen, nette Leute, tolle und vor allem produktive Atmosphäre. Ich falle erschöpft ins Bett.
Am nächsten Tag geht es raus: Zum einen sollen wir das Navigationsprogramm ein bisschen testen, indem wir durch die Gegend laufen und schauen, ob wir als ein Punkt angezeigt werden und die Route, die uns vorgeschlagen wird, richtig und schnell ist. Es ist überraschend genau, aber hier und da merkt man, dass all das Prototypen sind. Zweiter Gang: Samantha. Sie hat noch einen Kinderblindenstock, für den sie eindeutig zu groß ist. Sehr umständlich und mithilfe von jeder Menge pinkem Gaffatape bringen wir das weiße Board und den Arduino an den Stock an. Peter, ein erfahrener Junge, der an einem Einhornspiel arbeitet, wird mir später erzählen, dass es sowohl die Arduinos als auch die Boards in einer Nanovariante gibt und man sie mit Ausnahme des Ultraschallsensors innerhalb des Stocks anbringen könnte. Ich rufe mir das Motto „Prototyp“ ins Gedächtnis. Trotzdem behalte ich Peters Idee im Hinterkopf. Es kommen Interessent*innen von der BARMER, der <ode-University, vom Kinderkanal und eine StartUp-Gründerin, die von unserem Projekt sehr angetan sind, was uns natürlich sehr freut. Wir arbeiten nun an den Alarmstufen. Das Programm sieht drei davon vor, bei denen der Sensor unterschiedlich piept. Wir ändern die Stufen, schließlich soll der Stock so früh wie möglich zu erkennen geben, dass ein Hindernis naht. Abends rennen wir die ganze Zeit gebückt, mit einem Akku für die Stromzufuhr des Arduino in der einen und dem Stock in der anderen Hand durch das Workspace. Schon ist der zweite Tag vorbei.
Der dritte Tag beginnt auf eine äußerst ungünstige Weise: Nika ist krank. Ich mache dennoch weiter, probiere herum, versuche, LEDs anzubringen, die die drei Punkte aufblinken lassen sollen, damit im Dunkeln verdeutlicht wird, dass sich ein blinder Mensch nähert und man aufpassen muss. Im Nachhinein stelle ich fest, dass dies im Prinzip gegen unsere Idee spricht. Die sehbehinderten Leute sollen durch unseren Stock selbstständiger sein und sich nicht mehr so fühlen, als wären sie ein Problem, da alle auf sie achten müssen. Aber diesen Einfall bekomme ich währenddessen nicht. Stattdessen suche ich abwechselnd Pascals oder Peters Rat, denn mit den Widerständen vor und hinter den Leuchtdioden bin ich komplett überfordert. Bestimmt fünfmal versucht Pascal mir zu erklären, auf welcher Seite des Boards der Strom wie fließt, aber mein Kopf raucht schon beim ersten Mal. Physik eben. Der Strom reicht für die vielen LEDs aber sowieso nicht aus, weshalb ich letztendlich das leuchtende Zeichen ganz weglasse. Denk dran. Prototyp. Nicht mehr, nicht weniger. Den restlichen Tag verbringe ich mit ziellosem Rumgerenne durch das Workspace und draußen, um den Ultraschallsensor zu „perfektionieren“. Ab nach Hause, gegessen hab ich ja schon, hinlegen, gute Nacht.
Nächster Tag: Stichtag. Heute werden wir unsere Produkte vor Eltern und weiteren Interessenten vorstellen. Dazu feilen Zahid (der Website-Designer) und ich an der Präsentation bzw. Moderation. Uns hilft Amanda, eine der Coaches. Sie kommt wie viele andere auch aus den USA. Von ihr bekommen wir im Schnelldurchlauf erklärt, wie man sein Produkt am besten präsentiert. Einige Stunden später ist es so weit. Wir stehen relativ oben auf der Liste. Nach sogar recht professioneller Vorstellung des „SmartSticks“, wie ich ihn getauft habe, gibt es tosenden Applaus. Und wir schwören uns, weiter an dem Stock zu arbeiten – auch außerhalb des Camps.