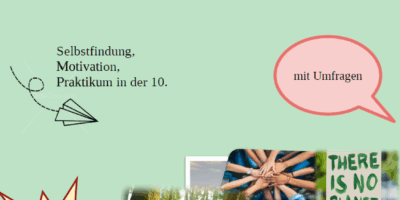Ein Beitrag von Lisa Rosenbaum, Abiturientin der Fichtenberg-Oberschule des Jahrgangs 2015. Teil 1 finden Sie hier.
Zwischenbemerkung der Autorin: Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle hier geschilderten Erfahrungen und Einschätzungen lediglich meine Ansicht wiedergeben. Sie sollen weder ein zu befolgendes Beispiel noch eine abschreckende Darstellung sein. Jeder junge Mensch muss seine ganz eigenen Erfahrungen sammeln und individuelle Schlüsse daraus ziehen.
Ich verbrachte einige Wochen in Berlin und stieg dann erneut in einen Flieger, um in Mexiko den „Tag der Toten“ miterleben zu können. Angekommen in Cancún zog ich nach wenigen Strandtagen nach Tulum und Valladolid weiter. Dort besuchte ich Cenoten, die mich bis heute durch ihre natürliche Schönheit berühren. Cenoten sind Kalksteinhöhlen, die durch den Einsturz der Höhlendecke entstanden und mit Süßwasser gefüllt sind. Eine Erkundung der Maya-Ruine Chichén Itzá durfte nicht  fehlen und bot viele interessante Fakten über die antiken Kulturen in Mexiko. Zum Día de los Muertos am 1. November flog ich dann nach Mexico City. Nachhaltig hat mich dort die gesamte Geschichte der Christianisierung berührt und wie die Indigenen sich dagegen gewehrt haben und teilweise neue synkretistische Elemente mit in die Religion eingingen. Der Tag der Toten ist ein Konglomerat aus indigener Religion und katholischen Vorstellungen der Missionare, der weltweit für Faszination und Interesse sorgt. Den tatsächlichen Feiertag durfte ich mit einem Mexikaner verbringen, den ich in Cancún kennengelernt hatte. Mit dem Miterleben vor Ort habe ich mir einen langen Traum erfüllt und bin bis heute von der gesamten mexikanischen Totenkultur fasziniert.
fehlen und bot viele interessante Fakten über die antiken Kulturen in Mexiko. Zum Día de los Muertos am 1. November flog ich dann nach Mexico City. Nachhaltig hat mich dort die gesamte Geschichte der Christianisierung berührt und wie die Indigenen sich dagegen gewehrt haben und teilweise neue synkretistische Elemente mit in die Religion eingingen. Der Tag der Toten ist ein Konglomerat aus indigener Religion und katholischen Vorstellungen der Missionare, der weltweit für Faszination und Interesse sorgt. Den tatsächlichen Feiertag durfte ich mit einem Mexikaner verbringen, den ich in Cancún kennengelernt hatte. Mit dem Miterleben vor Ort habe ich mir einen langen Traum erfüllt und bin bis heute von der gesamten mexikanischen Totenkultur fasziniert.
Durch meine Reise habe ich so viel Neues kennenlernen dürfen: Dass Obdachlose in Tokio sich niemals mit Schuhen auf eine Bank zum Schlafen legen; dass es in Tokio kaum öffentliche Mülleimer gibt, weil es in den 1990er Jahren verheerende  Nervengas-Terrorakte gab; dass Kaffee in Vietnam fast zu gleichen Teilen aus Kaffee und Kondensmilch besteht; dass Batik eigentlich bedeutet, Muster vor der Färbung mit Wachs auf Textilien zu malen; dass ich eine öffentliche Leichnamsverbrennung in einem Tempel in Laos miterlebte, während mir mein geliehenes Fahrrad geklaut wurde und mir dann zwei belgische Zahnärzte zur Seite standen; dass in Laos aus dem Stahl von amerikanischen Blindgängern aus dem Vietnamkrieg Armreifen gefertigt werden; dass in Mexiko in katholischen Kirchen lange Zeit die ursprünglichen indigenen Götter angebetet wurden und dass es möglich ist, spontan ein von einem Clown moderiertes Straßen-Dancebattle in Mexico City zu gewinnen.
Nervengas-Terrorakte gab; dass Kaffee in Vietnam fast zu gleichen Teilen aus Kaffee und Kondensmilch besteht; dass Batik eigentlich bedeutet, Muster vor der Färbung mit Wachs auf Textilien zu malen; dass ich eine öffentliche Leichnamsverbrennung in einem Tempel in Laos miterlebte, während mir mein geliehenes Fahrrad geklaut wurde und mir dann zwei belgische Zahnärzte zur Seite standen; dass in Laos aus dem Stahl von amerikanischen Blindgängern aus dem Vietnamkrieg Armreifen gefertigt werden; dass in Mexiko in katholischen Kirchen lange Zeit die ursprünglichen indigenen Götter angebetet wurden und dass es möglich ist, spontan ein von einem Clown moderiertes Straßen-Dancebattle in Mexico City zu gewinnen.
Im Allgemeinen habe ich mir keinen einzigen Reiseführer gekauft, sondern bin Empfehlungen von Einheimischen und anderen Reisenden gefolgt. Stets habe ich versucht, so viele Museen wie möglich zu besuchen und mich so viel wie möglich an die vor Ort herrschenden Lebensweisen anzupassen. Rückblickend muss ich jedoch sagen, dass das Reisen sehr anstrengend war. Es waren viele Eindrücke in sehr kurzer Zeit und ich habe es unterschätzt, dass alles auch verarbeitet werden muss. Ich habe es keine einzige Sekunde bereut, die Teilwelterkundung kürzer gestaltet zu haben als eingangs angedacht. Trotz dessen möchte ich meine Erlebnisse, die ich sammeln konnte, keinesfalls missen. Doch sei auch zu betonen, dass durch die achtwöchige Reise einige tausend Euro den*die Besitzer*in wechselten und mein ökologischer Fußabdruck durch all die Flugreisen nun einem Riesen gehört.
Rückblickend bezweifle ich, dass ich mich nochmals für eine derartige Reise entscheiden würde. Ich fühlte mich durch mein gesamtes Umfeld (Familie, Bekannte, Medien) unter Druck gesetzt, nun endlich einmal Auslandserfahrungen zu sammeln. Und so stand ich mit 18 Jahren auf einem völlig anderen Kontinent und musste sehr schnell realisieren, dass ich mit meiner Reise keinesfalls „irgendwie die Welt retten“ würde. Vielmehr war das Reisen etwas, von dem nur ich profitieren würde. Ich konnte jederzeit entscheiden, wieder zurückzukehren nach Deutschland und die Menschen ihrem dortigen Schicksal zu überlassen. Natürlich bringt man als Tourist*in Geld mit, doch auch Ansprüche, das physische Selbst sowie Erwartungen von den Zuhause-Gebliebenen. Bilder beispielsweise macht man doch eigentlich nur für andere und selten für sich selbst. Hinzu kommt, dass man das hart ersparte Geld aus dem Einmachglas gar nicht so gern aus der Hand geben möchte. Wie viel nützt es also wirklich den Menschen vor Ort?
Ein gutes halbes Jahr nach meinem Abitur fand ich mich im Anschluss an meine kleine Rundreise in Berlin wieder. Ich suchte mir mit einer damaligen Arbeitskollegin meine erste eigene Wohnung und beschloss ziemlich zeitnah, dass die Vollzeitarbeit, die ich hatte, nichts war, dass ich die nächsten 10 Monate weiter machen wollte. Ein Start des Studiums zum nächsten Wintersemester lag so weit in der Ferne, dass ich mich über Alternativen schlau machte. Ich landete bei einer sehr netten und kompetenten Beraterin der Arbeitsagentur, die mir nahelegte, den Blick von den Universitäten zu den Hochschulen zu lenken. Durch einschlägige Erfahrungen auf meiner Reise und Vorgedanken im Leistungskurs Sozialwissenschaften wollte ich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften anstreben. Besonders die Volkswirtschaftslehre reizte mich, da sie sich mit den großen Zusammenhängen unserer globalisierten Wirtschaft beschäftigt. Zu meinem Überraschen und Wohlwollen bot die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ein Beginn des Studiums zum Sommersemester an. So kam es, dass ich alles auf eine Karte setzte und mich lediglich für „Economics“ dort bewarb.
Meine damalige Entscheidung war die richtige! Ich wurde angenommen und konnte zum Sommersemester mein VWL-Studium aufnehmen. Den größten Unterschied zwischen Universität und Hochschule bemerkt man bereits in den Vorlesungen: ein Audimax mit circa 700 Leuten gegen einen Seminarraum mit circa 40 Studierenden. Das, was an der Uni aufgeteilt ist in Vorlesung und Seminar, ist bei uns eine vierstündige Veranstaltung, in der mit dem*der Professor*in Übungen bearbeitet werden. Generell ist der Kontakt zu den Lehrpersonen wesentlich einfacher herzustellen und von beiden Seiten gern wahrgenommen. Eine weitere, bedeutende Abweichung von der Universität ist, dass wir ein fest eingeplantes Praxissemester haben. Darin wird ein halbjähriges Vollzeitpraktikum absolviert, das die „angewandte Wissenschaft“ verkörpern soll.
Ich selbst stehe kurz vor meinem Praxissemester und blicke auf fünf spannende Semester zurück, in denen meine Faszination für dieses Themengebiet stetig zugenommen hat. Mir ist bewusst, dass es absolut nicht der Maßstab ist, bei seiner ersten Wahl schon gleich einen Volltreffer zu landen. Doch für meinen Fall gesprochen, hätte es keinen besseren Weg geben können. Es ist unheimlich wichtig, sich seiner eigenen Interessen klar zu sein und diese als Orientierung zu nehmen. Keine Person kennt einen so gut, wie man selbst und deshalb kann keine*r bessere Entscheidungen treffen als man selbst. Das, was einen durch Studium/Lehre/Ausbildung treibt, sind nicht die Wünsche anderer, sondern die eigenen Vorlieben und Interessen.
So kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, auf das eigene Herz zu hören und sich freizumachen, von Ängsten und Erwartungen anderer Menschen.